GEHEN, GING, GEGANGEN
Donnerstag, 24. September 2015
Autorin
Jenny Erpenbeck bekam die Schriftstellerei qausi in die Wiege gelegt: der Vater John Erpenbeck veröffentlichte mehrere Bücher, darunter auch einige Romane. Die Mutter Doris Kilias übersetzte viele Werke aus dem Arabischen in Deutsche.
Die Autorin arbeitet auch als Theaterregisseurin, bekam schon zahlreiche Literaturpreise (vielleicht kommt ja jetzt noch einer dazu?) und lebt in Berlin. Sie wurde übrigens im gleichen Jahr geboren wie ich.
Buch
Dieses Buch behandelt ein brandaktuelles Thema: das Leben von Flüchtlingen in Deutschland und wie deutsche Einwohner damit umgehen.
Richard, frischer Rentner, lebt alleine in einem schönem Haus an einem See in Berlin. Der ehemalige Professor hat für seinen Ruhestand keine großen Vorhaben geplant. Er lebt einsam und gelangweilt ein paar Wochen vor sich hin.
Da kommt er, eher zufällig, auf den Oranienplatz. Dort hausen Hunderte von Flüchtlingen in einem Camp und versuchen auf ihre Lage aufmerksam zu machen. Richard beschliesst mit einigen von ihnen zu sprechen, um vielleicht eine Art Studie zu entwickeln. Planmässig und wisesnschaftlich geht er vor. Endlich hat er sich selbst eine Aufgabe erschaffen. So entwirft er einen langen Fragenkatalog, mit dem er Betroffene interviewen kann.
Die Flüchtlinge, größtenteils aus verschiedenen afrikanischen Ländern, müssen ihr Camp selbst abbauen und bekommen feste Unerkünfte zugewiesen und die Zusicherung einer baldigen Prüfung ihres Status. Richard beginnt sich mit einigen zu unterhalten. Er lernt ihre Schicksale und die gegewärtige Lage kennen. Dadurch wird er immer tiefer in diese Gemeinschaft hineingezogen.
Plötzlich ist Richard nicht mehr allein und ohne Aufgabe. Es gibt viel zu tun. Deutschunterricht, Behördengänge, Unterstützungen vielfältiger Art. Er gewinnt Freunde und Einblicke in andere Kulturen. Dabei hat er auch Gelegenheit sein eigenes Leben zu reflektieren.
Sehr schön sind die Vergleiche, die er zu seinem einstigen Fachgebiet, Richard war Philologe, zieht. So werden seine neuen Freunde in seinen Gedanken zu Tristan, Hermes…
Das Thema Heimat versus Heimatland wird auch sehr schön untersucht. In Afrika wurden viele Grenzen nicht nach den Territorien der Menschen dort, sondern in geraden Linien gezogen. In Deutschland bekamen die DDR-Bürger plötzlich auch einen neuen Pass, ein neues Land zugeteilt:
1990 war er plötzlich, von einem Tag auf den anderen, Bürger eines anderen landes gewesen, nur der Blick aus dem Fenster war noch derselbe.
Auch über die Willkür der Herkunft wird nachgedacht:
Wenn es nicht ihr eigenes Verdienst war, dass es ihnen so gut ging, war es andererseits auch nicht die Schuld der Flüchtlinge, dass es ihnen so schlecht ging. ebensogut könnte es umgekehrt sein.
Eine Gedanke, der mir auch schon oft gekommen ist.
Wie wird die Zukunft seiner neuen Freunde aussehen? Welch Rolle wird Richard dabei spielen?
Er lernt die deutsche und europäische Bürokratie und Gesetzgebung von einer neuen Seite kennen. Einzelfälle und Schicksale spielen keine Rolle. Internationale Übereinkünfte wie das Dubliner-Abkommen bekommen für ihn plötzlich Inhalt. Erst jetzt versteht er die Auswirkungen der zum Teil shizophren wirkenden internationalen Flüchtlingspolitik. Viele Parallelen zu aktuellen Berichten werden deutlich.
Die Menschen, alles Männer, wollen eine Zukunft. Sie wollen sichtbar werden. Aus diesem Grund veranstalten zum Beispiel sechs von Ihnen eine Art von Demonstration. Einen Hungersstreik auf dem Alexanderplatz. Sie haben Schilder auf denen steht „We become visible“. Trotzdem werden sie, auch von Richard, übersehen.
Arbeit, Beschäftigung ist auch etwas was sie wollen. Viele haben noch Angehörige in ihren Herkunftsländern, denen Sie gerne etwas Geld schicken würden. Und diese vielen, langen Tage des Nichtstuns sind für einige unerträglich. So wie auch für Richard, als er emeritiert wurde.
Für mich eine Überraschung: in diesem Buch wird Klavier gespielt! Diese Szenen waren für mich einfach wunderbar.
Und im Hintergrund liegt immer der kleine See hinter Richards Haus. Der See, in dem einen ganzen Sommer keiner baden geht, weil dort eine Leiche auf dem Grund liegt und nicht geborgen werden konnte. Welch passender Vergleich zur Handlungssituation im Buch.
Fazit
Für mich ein lesenswertes Buch, das mich sprachlich und inhaltlich überzeugt. Es gibt mir bei vielen Aspekten Grund zum Nachdenken. Nur der Schluss überzeugt mich nicht ganz. Stilistisch hatte ich plötzlich das Gefühl in einem anderen Buch zu stecken, inhaltlich fühlte ich mich irgendwie nicht mehr ganz abgeholt. Allerdings fand ich die letzten Seiten, in denen Richard das Verhältnis zu seiner Frau reflektiert, sehr stark.
Jenny Erpenbeck: Gehen, ging, gegangen, 352 Seiten, Knaus Verlag, ISBN 978-3-8135-0370-8, € 19,99 [D]
Abschlusszitat
Damals, glaube ich, sagt Richard, ist mir klar geworden, dass das, was ich aushalte, nur die Oberfläche von all dem ist, was ich nicht aushalte.
PS: Im Web findet man viele Artikel zu den tatsächlichen Geschehnissen rund um die Flüchtlinge am Oranienplatz, die im Jahr 2014 ihre notdürftigen Zelte dort abgebrochen haben. Es lohnt sich da etwas zu recherchieren.
♌
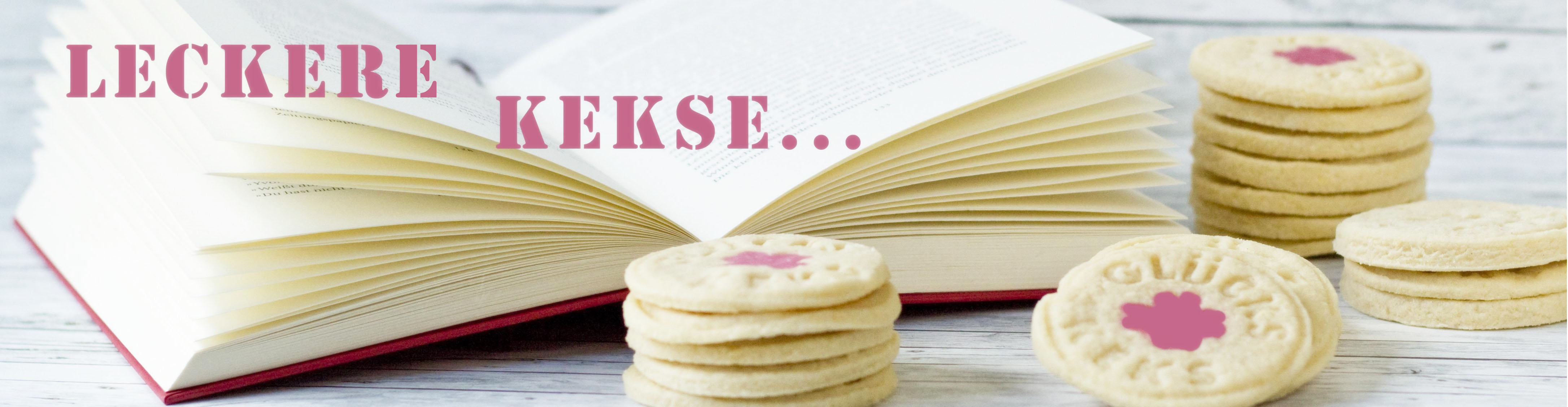
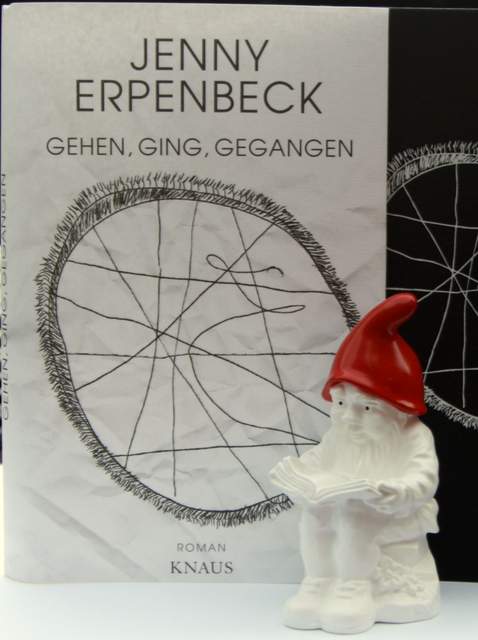
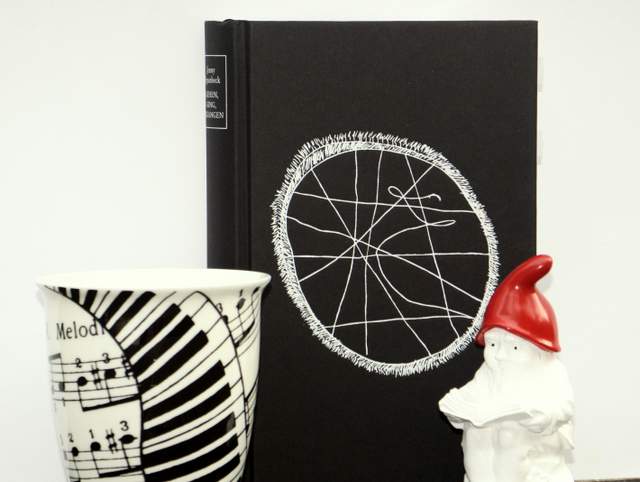
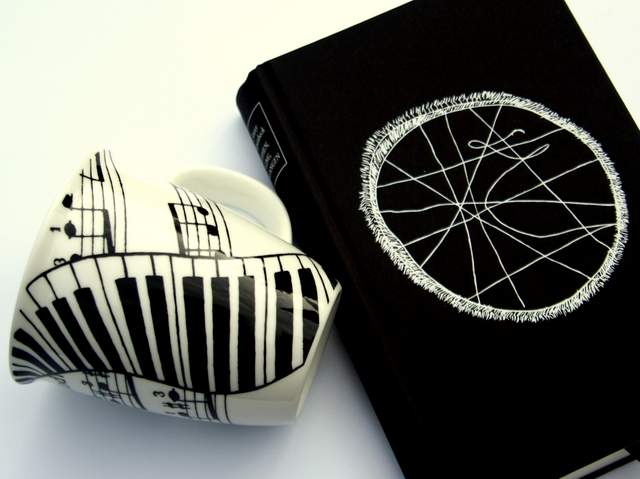
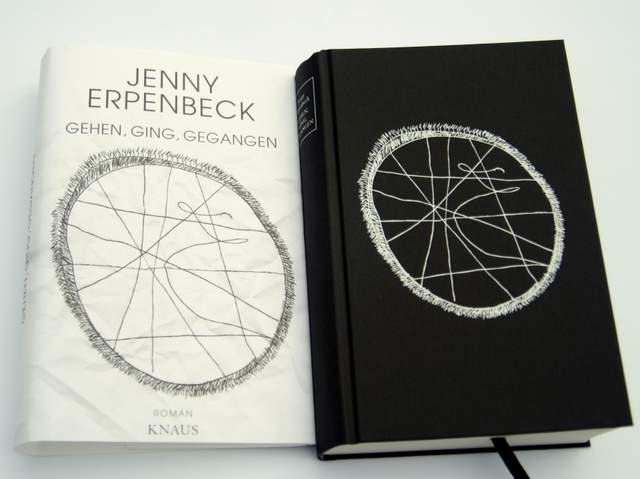


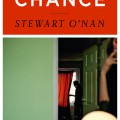

Danke für diese tolle Rezension. Das Buch ist auch gleich auf meine Wunschliste gewandert, als ich die Leseprobe durch hatte. Dass jetzt zum Teil so heftige Kritik gegen dessen Nominierung auf der Shortlist zum Buchpreis aufkam, fand ich etwas schade. Allerdings habe noch keines der nominierten Bücher gelesen und kann daher nicht mitreden. Trotzdem zeigt mir Deine Rezension, dass ich vielleicht doch nicht so allein mit meiner Einschätzung bin, was ich sehr schön finde.
Danke, das Buch empfinde ich als lesenswert. Die Diskussionen um die Shortlist dieses Jahr als etwas anstrengend.
Pingback: [ Mikka liest das Leben ] [ Rezension ] Jenny Erpenbeck: Gehen, Ging, Gegangen