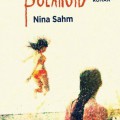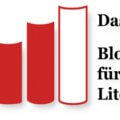Raubfischen
Sonntag, 26. April 2015
 ALS = Amyotrophe Lateralsklerose. Durchschnittliche Überlebenszeit: 3-5 Jahre. Degenerative Erkrankung des motorischen Nervensystems.
ALS = Amyotrophe Lateralsklerose. Durchschnittliche Überlebenszeit: 3-5 Jahre. Degenerative Erkrankung des motorischen Nervensystems.
Bedeutet: der Körper eines Menschen wird unaufhaltsam zum lebensunfähigen Wrack, während der Geist intakt bleibt.
Diese Diagnose bekommt Daniels Großvater. Am Anfang merkt man nicht viel. Er verschluckt sich häufig, die Stimme wird undeutlicher, die Kartoffeln werden langsamer geschält.
Die Mutter meint in einer SMS „Wenn es doch bloß Alzheimer wäre. Aber er bekommt ja alles mit, er verblödet ja nicht.“
Fischen mit dem Großvater: „Das Sirren meiner angespannten Schnur, das unruhige Wasser, mein unruhiger Körper, nach allen Seiten flüchtende Fische, das Reißen der Schnur.“
Das enge Verhältnis zwischen Enkel und Großvater bekommt in den Sommerferien in Schweden einen Riss. Ein Streit, Lügen, ignorierte Verbote. Später erscheint das als verlorene Zeit. Zeit, die man friedlich mit dem Großvater hätte verbringen können.
ALS ist eine Diagnose ohne Hoffnung.
Und doch keimt sie auf:
Wenn er lange genug kaut, verschluckt er sich nicht. Daran hat es gelegen. Die ganz Zeit.
Mit welcher Deutlichkeit er spricht. Mit jedem Satz weicht die Krankheit aus ihm.
Die Krankheit ist ihm abhandengekommen.
Vielleicht findet er sie nie wieder.
Doch dieser Eindruck trügt. Irgendwann findet die Krankheit den Großvater wieder. Sie hat sich nur versteckt und macht die gewonnene Zeit wieder wett. Ganz schnell kann er viele „normale“ Sachen nicht mehr. Fahrradfahren, Feinmotorik, Schnürsenkel binden.
So auch sprechen:
Erst viele Wochen, nachdem Großvater seine Stimme verloren hatte, habe ich mit der Suche begonnen. Eine Suche, an der ich niemanden teilhaben lasse, die ich nur für mich betreibe. Großvaters letztes Wort.
In dem Moment, in dem man etwas zum letzten Mal schafft, weiß man noch nicht, das es nicht ein weiteres Mal gelingen wird. Dinge, die vorher selbstverständlich waren, gelingen einfach nicht mehr. Irgendwann kann der Patient auch nicht mehr atmen.
Doch als ob der Junge von der Pubertät und der Krankheit seines Großvaters noch nicht genug gebeutelt wäre: es trennen sich auch noch seine Eltern. Ob die Fixierung der Familie auf die Krankheit ein Grund dafür ist? Diese Frage bleibt offen. Auch ein paar andere Enden baumeln lose herum. Dinge, die dem Jungen nicht klar werden, bleiben auch dem Leser unklar.
Das ändert sich im zweiten Teil ein wenig. Dort werden auch Dinge erzählt, die Daniel nicht selbst erlebt. Ob die Großmutter später einiges an Erinnerungen mit ihm teilte? Das bleibt offen.
Raubfischen ist ein sehr persönliches Buch. Es beschreibt die Beziehung zwischen dem Autor und seinem Großvater. Einem Großvater, der an ALS litt. Auf der Webseite des Autors findet man einen Buchtrailer, Lesungstermine, Pressestimmen und eine Leseprobe.
„Raubfischen“ ist selbst in zwei „Bücher“ unterteilt. Im zweiten Buch hat die Krankheit den Großvater fest im Griff. Er musste in ein Pflegeheim, bald soll die Magensonde gesetzt werden. Dieses Leben ist nicht mehr lebenswert. Daniel will dem Großvater seinen letzten Wunsch erfüllen: er bringt ihn nochmal nach Schweden. In die kleine Ferienhütte, an den See, noch einmal angeln. Auch wenn der Großvater es nicht mehr selbst kann. Dieses Ferienhäuschen wird an einer Stelle so beschrieben:
Es ist ein schönes Haus, in einem schönen Land, an einem schönen See.
Was will man mehr?
In diesem Teil sind auch drei Zeichnungen von Fischen enthalten. Und auch Geschichten über Fische, Erklärungen zu ihrem Verhalten und einige Details zum Angeln. Diese Informationen waren mir alle neu, weil Angeln in mir selbst nur ein großes Fragezeichen auslöst.
Diese kleinen Geschichten über Fische und Angeln sind aber sehr schön geschrieben und regelrecht spannend. Hätte ich nicht gedacht. Ich muss zugeben, daß Angeln für mich ein Synonym für Langeweile war.
Die Perspektiven und Zeiten wechseln in diesem zweiten Buchteil. Es wird auch erzählt, wie die Großeltern dieses Haus fanden, kauften und sich darüber fast entzweiten, wie eine Feindschaft zwischen zwei Männern entsteht und ein älterer Mann einem kleinen Mann eine Reise schenkt, in dem sie beide „über das Wasser gehen werden“. Erst in diesem Teil wird richtig klar, wieso das Verhältnis der beiden so eng ist.
Doch zurück zu dieser Krankheit:
Er schmecke alles wie vorher. Es täte ihm gut, manchmal Dinge zu schmecken, die er kennt. Dinge, die er mag, an die er gute Erinnerungen habe.
Daniel nimmt sich da wirklich was vor: mit einem Mann, der nicht mehr gehen, sprechen, trinken, essen, atmen kann mit dem Auto in ein anderes Land fahren, in eine Hütte, die nicht gerade Luxus bietet. Daniel ist selbst nur knapp erwachsen, darf gerade mal Autofahren. Ich glaube über die übernommene Verantwortung ist er sich nicht klar. Seine ganze Solidarität und Aufmerksamkeit gehört seinem Opa. Dies muss ein Junge auf der Fähre auch recht schmerzhaft erfahren (mehr will ich nicht verraten).
Sterbehilfe ist natürlich auch ein Thema. Aber nur ein kleines. Es geht eher Richtung Sterbeunterstützung:
Die Palliativmedizin bietet aus ihrem lebensbejahenden Ansatz heraus Hilfe beim Sterben an, jedoch nicht Hilfe zum Sterben.
So paradox es sich anhört: Raubfischen behandelt den Umgang mit einer schrecklichen, hoffnungslosen Krankheit. Aber es ist durchaus lebensbejahend. Alle versuchen, bis auf einen Schwächemoment, das Beste aus der Situation zu machen. Das finde ich sehr bewundernswert.
Sehr gut gefällt mir der Schluss dieses Debütromans. Er findet ein versöhnliches Ende, indem er das tatsächliche Ende ausspart.
♌
Matthias Jügler: Raubfischen, Blumenbar (aufbau Verlag), ISBN: 978-3-351-05014-6, 224 Seiten, 16,00 € [D]